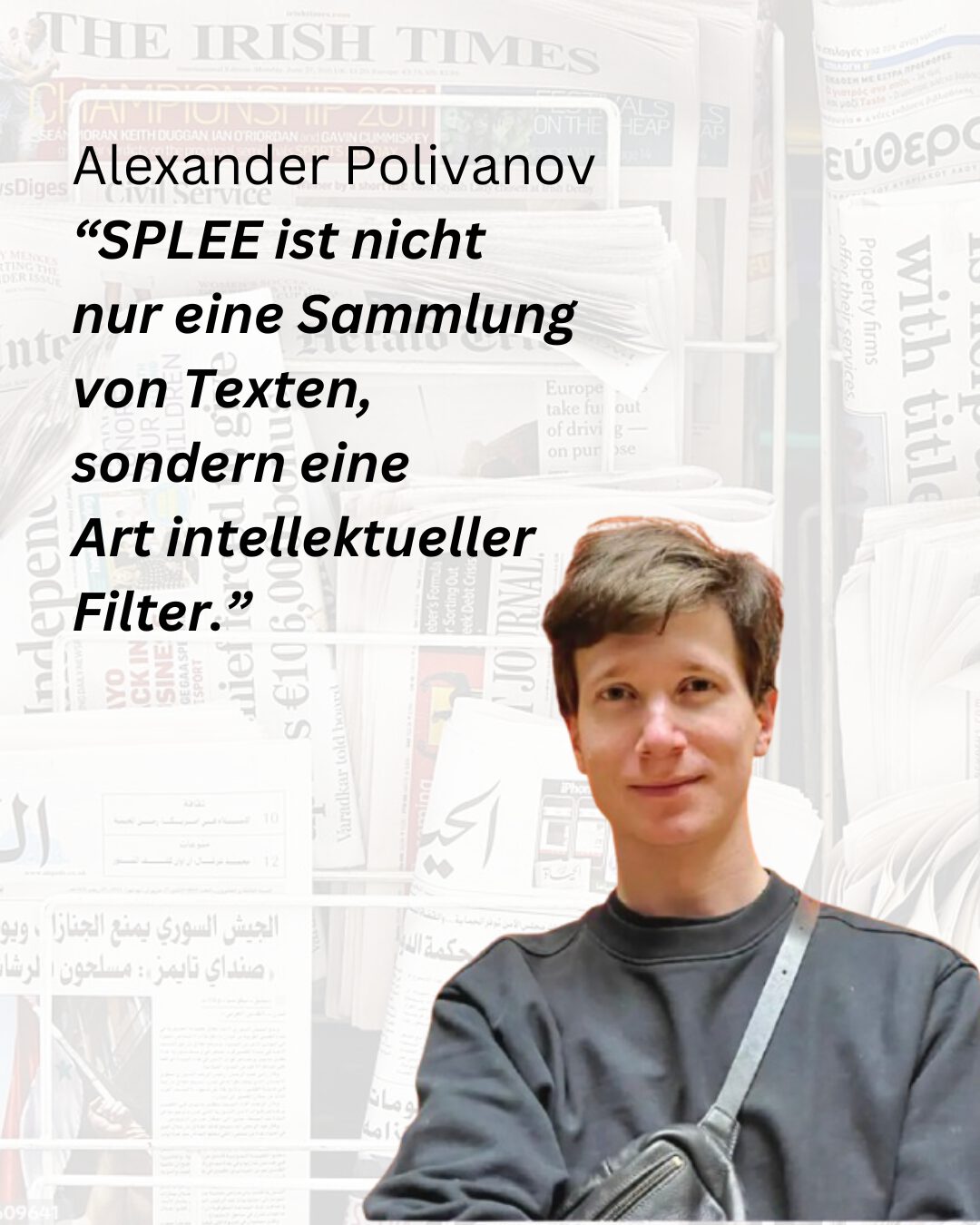Das Deutsche Institut für gutes Leben freut sich, Alexander Polivanov als neuen Mitarbeiter zu begrüßen. Als Kurator, Musikwissenschaftler und Kulturmanager verbindet er Kunst, Musik und Medien und setzt sich mit kultureller Identität, politischem Wandel und gesellschaftlicher Teilhabe auseinander. Am difgl wird er am Projekt SPLEE – Streaming Plattform für Longreads und Essays aus Europa – mitwirken. Dabei bringt er seine umfassende Erfahrung in kultureller Emigration, interdisziplinärer Kunstpraxis und digitalem Publizieren ein. Seine Perspektive als Forscher und Mediengestalter ist eine unheimliche Bereicherung für das Projekt und ermöglicht es, SPLEE als innovatives Format für tiefgehende Debatten zu etablieren. Im Interview sprechen wir über seinen Werdegang, die Rolle von Kunst für gesellschaftlichen Wandel und seine Arbeit am difgl.
1. Ihr Weg hat Sie von der klassischen Musik über das Kulturmanagement bis zur Forschung geführt. Was hat Sie motiviert, diese verschiedenen Disziplinen miteinander zu verbinden?
SPO: Musik ist seit meiner Kindheit meine Leidenschaft, und ich habe schon mit 10 Jahren entschieden, Musiker zu werden. Mein Interesse beschränkte sich nie darauf, ein Instrument zu spielen — für mich war es wichtig zu verstehen, wie ein Musikstück strukturiert ist, wann es geschrieben wurde und wer es inszeniert hat. Wenn ich zum Beispiel eine Oper spielte, wollte ich alles über den Komponisten, den Regisseur, die Sänger und die Inszenierung wissen, auch wenn das für einen Orchestermusiker nicht wichtig ist. Dieser weite Blick auf die Künste führte mich nach und nach über den Musikinterpretationsrahmen hinaus, zunächst zum Kuratieren von Musik, dann zum Kulturmanagement und zur Forschung. Ich bin davon überzeugt, dass verschiedene Lebensbereiche nicht isoliert voneinander existieren und dass es immer möglich ist, gemeinsame Schnittpunkte zwischen scheinbar weit voneinander entfernten Bereichen zu finden. Wenn man sie richtig kombiniert, entwickelt sich eine «Chemie», die beide Sphären viel mehr bereichert, als wenn sie sich isoliert entwickelt hätten.
2. Am difgl beschäftigen wir uns intensiv mit gesellschaftlichem Wandel und guten Lebensbedingungen. Inwiefern kann Kultur – insbesondere Musik – dazu beitragen, soziale und politische Veränderungen anzustoßen?
SPO: Musik ist eine universelle Sprache, die jede*r versteht, unabhängig von Bildung und Hintergrund. Für mich ist Kultur im Allgemeinen ein Mittel, um Informationen und Werte nicht auf genetischem, sondern auf sozialem Wege weiterzugeben, wodurch die Identität einer Gesellschaft geformt wird. Da Kultur eng mit dem kollektiven Bewusstsein verbunden ist, beeinflusst sie unweigerlich soziale und politische Prozesse. Musik kann inspirieren, Menschen zusammenbringen und sogar ein Katalysator für Veränderungen sein. Deshalb ist es so wichtig, dass staatliche Kulturpolitik gut durchdacht ist und zu positiven Veränderungen in der Gesellschaft beiträgt.
3. Ihr Forschungsprojekt an der Humboldt-Universität zu musikalischer Emigration zeigt, wie politische Rahmenbedingungen Kultur beeinflussen. Welche Parallelen sehen Sie zwischen historischen und aktuellen Entwicklungen?
SPO: Die Geschichte der russischen musikalischen Emigration zeigt, dass Kultur immer eng mit den politischen Verhältnissen verbunden war. Jahrhunderts war die Emigration von Musikern oft mit der Suche nach kreativer Freiheit und der Integration in den westlichen kulturellen Kontext verbunden (z.B. Diaghilew und Strawinsky). In der zweiten Hälfte des Jahrhunderts verließen viele Musiker das Land unter dem Druck des sowjetischen Regimes — darunter Rachmaninov und Prokofiev, die sowohl Opfer des Systems als auch dessen Symbole wurden. Die aktuellen Ereignisse wiederholen in vielerlei Hinsicht diese historischen Emigrationswellen. Der Krieg in der Ukraine hat zu einer neuen Emigrationswelle russischer Musiker geführt, aber ihre Lage ist jetzt noch schwieriger. Sie werden nicht nur mit einer reichen Musiktradition in Verbindung gebracht, sondern auch mit dem Aggressorstaat, was sich auf ihre Kreativität auswirkt und sogar ihre Karriere behindert. Diese kulturelle Kluft ist eines der Hauptthemen meiner Forschung: Wir beobachten heute, wie sich die Wahrnehmung der emigrierten Musiker durch das Prisma der Politik verändert. In einer Welt, in der der Informationsfluss immer schneller wird, sind Longreads besonders wichtig, weil sie es den Leserinnen und Lesern ermöglichen, ihre Gedanken zu strukturieren und komplexe Themen zu vertiefen.

4. Mit SPLEE entsteht eine Streaming-Plattform für Longreads und Essays aus Europa. Welche Rolle können solche Formate in einer Zeit spielen, in der Aufmerksamkeitsspannen kürzer werden – und wie tragen sie zur demokratischen Debatte bei?
SPO: In einer Welt, in der der Informationsfluss immer schneller wird, sind Longreads besonders wichtig, weil sie es den Leserinnen und Lesern ermöglichen, ihre Gedanken zu strukturieren und komplexe Themen zu vertiefen. SPLEE ist nicht nur eine Sammlung von Texten, sondern eine Art intellektueller Filter, der starke Essays aus ganz Europa auswählt. Darüber hinaus hilft die Plattform, sprachliche und nationale Barrieren zu überwinden, damit sich die verschiedenen EU-Länder besser verstehen. So entsteht ein Raum für einen gemeinsamen Dialog jenseits von Schlagzeilen und momentanen Ereignissen.
5. Was bedeutet für Sie persönlich „gutes Leben“ – und welche Rolle spielen Kunst und Kultur dabei?
SPO: «Gutes Leben» ist für mich ein sinnerfülltes Leben. Und Sinn bedeutet für mich, sich selbst in der Gesellschaft zu erkennen und die Gesellschaft durch sich selbst zu verstehen. Kultur spielt dabei eine Schlüsselrolle: Sie prägt unsere Identität, gibt uns Werkzeuge an die Hand, um die Welt zu interpretieren, und hilft uns, eine gemeinsame Basis mit anderen zu finden. Ich verstehe Kultur in einem weiten Sinne — von Sprache, Architektur und Kunst bis hin zu Wissenschaft und Politik. All dies schafft einen Orientierungsrahmen, in dem wir uns selbst und unseren Platz in der Welt erkennen.